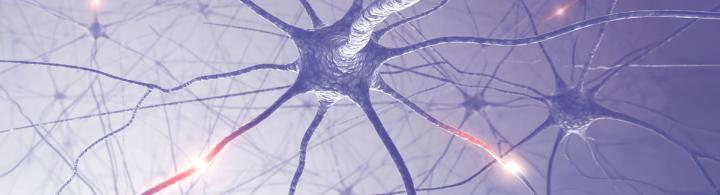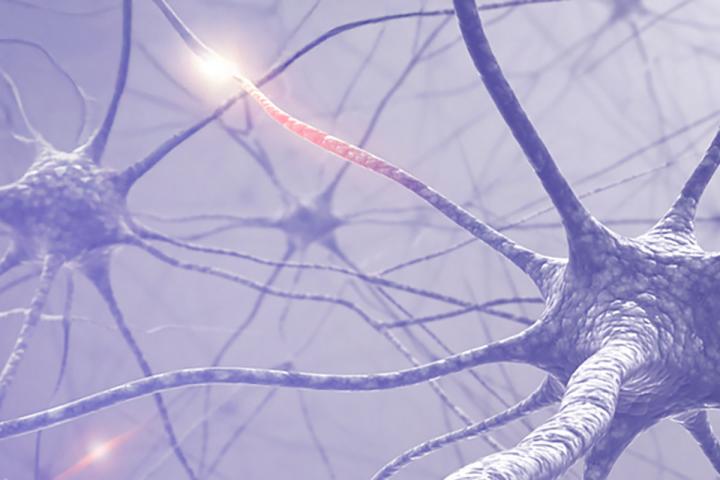Wie bei anderen Autoimmunerkrankungen auch, haben sich Therapien, die regulierend auf das Immunsystem einwirken, bewährt. Dabei gelten intravenöse Immunglobuline (IVIG) und Plasmapherese für die Behandlung von GBS als vergleichbar wirksam und besser als Placebo. Eine Kombination der beiden Therapien bringt keinen zusätzlichen Vorteil.
Glukokortikosteroide und andere Immunsuppressiva sind nicht wirksam und sollen daher nicht gegeben werden.
Prognose
GBS ist in der Regel gut behandelbar, die Hälfte bis zwei Drittel der Patient:innen erholen sich vollständig, auch wenn der Heilungsprozess länger dauern kann. 20% der Betroffenen können Langzeitsymptome oder Folgeschäden zurückbehalten.3,4
Beweglichkeitsbeeinträchtigungen und Fatigue können auch langfristig die Lebensqualität der GBS-Patient:innen beinträchtigen. In seltenen Fällen (3%) kann GBS auch tödlich verlaufen.3
Höheres Alter bei Krankheitsbeginn (> 50 Jahre), rasche Progredienz der Erkrankung, schwere Symptome mit hochgradigen Paresen und/oder Beatmungspflichtigkeit, ein ausgeprägter axonaler Schaden und eine auslösende Infektion mit Camphylobacter jejuni und
Cytomegalovirus (CMV) gelten als prognostisch ungünstig.5
Bei der selteneren GBS-Variante AMAN kann trotz oft schwerem Verlauf eine schnelle Erholung folgen. Sind die axonalen Schäden allerdings schwerwiegend, dauert es deutlich länger. Patient:innen mit einer Erkrankung des Miller-Fisher-Syndrom (MFS) erholen sich meist innerhalb weniger Monate. Bei MFS-Patienten mit Schwäche der Gliedmaßen (MFS-GBS-Überlappungssyndrom), kann die Erkrung allerdings bis zum Versagen der Atmung voranschreiten.
Eine weitaus bessere Prognose als Erwachsene haben Kinder und Jugendliche. Sie erholen sich in den meisten Fällen oder behalten nur geringfügige, selten behindernde Symptome zurück. Allerdings kann es nach überstandener Erkrankung zu Verhaltens- und emotionalen Störungen kommen, was für die langfristige Betreuung berücksichtigt werden sollte.6
Mehr zu den Formen des GBS
Hochdosierte intravenöse Immunglobuline
-
Bei der Behandlung von GBS haben sich intravenöse Immunglobuline (IVIG) als gut wirksam erwiesen, wobei der genaue Wirkmechanismus nicht geklärt ist. Insbesondere GBS-Patient:innen mit einer schnellen Progression und einem schweren Verlauf profitieren von IVIG.
Medikament/Verfahren
IVIG
Evidenz, Empfehlungs-stärke
Ib, A
Dosierung
0,4g/kg KG/Tag an 5 Tagen oder 1 g/kg KG/Tag an 2 Tagen
Kontra-indikationen
Überempfindlichkeit gegen homologe Immunglobuline, dekompensierte Herzinsuffizienz
Neben-wirkungen
Kopfschmerzen, anaphylaktische Reaktion (selten, bei IgA-Mangel), Erhöhung des Kreatininspiegels
Aufgrund der guten Datenlage bei Erwachsenen und die Einfachheit der Applikation lässt sich die IVIG-Therapie bei Kindern und Jugendlichen mit GBS als geeignet erscheinen. Trotz geringer Evidenzstärke, empfiehlt die Leitlinie bei Kindern und Jugendlichen mit schwerem GBS eine Behandlung mit IVIG wie bei Erwachsenen beschrieben. Die Behandlungen könnten die Dauer der schweren funktionellen Einschränkungen und der Lebensbedrohung mit ausreichender Wahrscheinlichkeit verkürzen.6
Nähere Informationen zu intravenösen Applikationen von Immunglobulinen finden Sie hier:
Plasmapherese
-
Die Plasmapherese stellt bei Erwachsenen GBS-Patient:innen das erste wirksame Therapieprinzip in schweren Fällen dar. Sie verbesserte in Studien die Dauer der assistierten Beatmung, das Wiedererlangen der unterstützten und freien Gehfähigkeit und die Wahrscheinlichkeit, dass GBS-Patient:innen nach 1 Jahr frei von schweren Langzeitsymptomen sind sowie ihre Muskelkraft zurückerlangen.6
Medikament/Verfahren
Plasmapherese1
Evidenz, Empfehlungsstärke
Ib, A
Dosierung
4 Plasmaaustausche mit je 1,5 Plasmavolumen über 1-2 Wochen
Kontraindikationen
Herzinsuffizienz, akuter Infekt, Gerinnungsstörung
Nebenwirkungen
Parästhesien, Muskelkrämpfe, kardiovaskuläre Komplikationen, Anaphylaxe gegen Albumin
Bei Kindern mit schweren GBS-Fällen empfiehlt die Leitlinie6 den Einsatz von Plasmapherese, sofern eine Kontraindikation gegen IVIG vorliegt oder die IVIG-Behandlung unwirksam ist. Allerdings sollte beim Therapiewechsel ein Abstand von zwei Wochen eingehalten werden.
Beachte! Die individuelle Erholung und das Ansprechen auf eine Therapie kann stark variieren. Trotz aller Erfolge sprechen nicht alle GBS-Patient:innen auf die IVIG- oder Plasmapherese-Behandlung an. Verschlechtert sich der Zustand innerhalb von 8 Wochen nach einer ersten Verbesserung nochmal, empfiehlt es sich die Therapie einige Wochen später zu wiederholen. Kommt es allerdings zu wiederholten Rezidiven oder es besteht ein kontinuierlicher progressiver Verlauf nach mehr als 8 Wochen, sollte das Vorliegen einer CIDP geprüft und entsprechend behandelt werden.
Mehr zu den Diagnosekriterien für CIDP
Kortikosteroide
-
Anders als bei anderen Autoimmunerkrankungen sind Kortikosteroide beim GBS nicht wirksam und können die Erholung möglicherweise hinauszögern.
Mehr zu den Therapiemöglichkeiten für CIDP
Behandlung mit Antibiotika
-
Eine Behandlung mit Antibiotika wird nur in Einzelfällen bei GBS-Patient:innen empfohlen, wenn eine Therapie einer eventuell auslösenden Krankheit durchgeführt werden muss.
Intensivmedizinische Versorgung
-
Bei einigen GBS-Patient:innen kann es zu akuter Atemnot und Herzrhythmusstörungen kommen. In diesem Fall ist eine Intensivmedizinische Überwachung und Unterstützung angezeigt.
Bei Patient:innen mit einer schnellen Progression der GBS-Symptome und insbesondere wenn die Nerven der Arme und des Gesichts betroffen sind, besteht erhöhte Gefahr, dass die Atemmuskulatur ebenfalls betroffen ist. Die Vitalparameter solcher Patient:innen sollten in der akuten Phase engmaschig überwacht werden, um ggf. eine assistierte Beatmung einleiten zu können.
Unterstützende Therapien bei GBS
Während der verschiedenen Phasen der Erkrankung können weitere Therapien die Lebensqualität der GBS-Patient:innen verbessern und die Erholung unterstützen:
-
Physiotherapie
in der Akutphase -
Schmerztherapie
gegen Parästhesien und Schmerzen (ggf. zusätzlich Antiepileptika und Antidepressiva) (bei Bedarf) -
Thromboseprophylaxe
bei eingeschränkter Beweglichkeit -
Psychologische Beratung
bei hochgradiger Funktionseinschränkung, Tetraparese und Beatmungs
- Sommer C. et al. Therapie akuter und chronischer immunvermittelter Neuropathien und Neuritiden, S2e-Leitlninet 2018. Verfügbar unter https://register.awmf.org/assets/guidelines/030-130l_S2e_Neuropathien_Neuritiden_2019-03-abgelaufen.pdf. Letzter Zugriff: 14.01.2025.
- Flink GR. et al. SOPs Neurologie 2018. Verfügbar unter https://www.thieme-connect.de/products/ebooks/lookinside/10.1055/b-0038-164073#. Letzter Zugriff: 14.01.2025.
- Orphanet, Seltene Krankheiten, Akute demyelinisierende inflammatorische Polyradikuloneuropathie. Verfügbar unter https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/OC_Exp.php?lng=DE&Expert=98916. Letzter Zugriff: 14.01.2025.
- Walling AD, Dickson G. Am Fam Physician. 2013;87(3): 191-197.
- Mäurer, M. Diagnostik und Behandlung des Guillain-Barré-Syndroms. DNP 18, 39–45 (2017). https://doi.org/10.1007/s15202-017-1500-6
- Gesellschaft für Neuropädiatrie: Diagnose und Therapie des Guillain-Barré Syndroms im Kindes- und Jugendalter, 4. Auflage, Version 1.0. Verfügbar unter https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/022-008.html. Letzter Zugriff: 14.01.2025.
C-APROM/DE/IG/0058